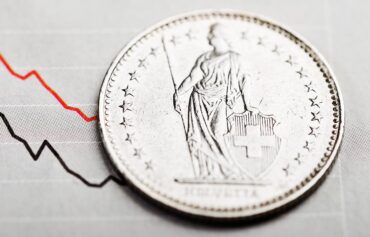- Altersvorsorge, Parlament, Politik - Tatiana Rezso
13. AHV: Finanzierung ohne notwendige Strukturreform

AHV: Finanzierung ohne notwendige Strukturreform. Die 13. AHV-Rente tritt 2026 in Kraft. Die technische Umsetzung ist geklärt. Ungewiss bleibt deren Finanzierung. Gravierend ist das Fehlen einer Gesamtvision. Mehr denn je braucht es eine Strukturreform für die AHV, die überzeugende Lösungen für die demografischen Herausforderungen bietet.
Keine nachhaltige Finanzierung
Am 3. März 2024 hat das Schweizer Volk die Volksinitiative für eine 13. AHV-Rente angenommen. Gestärkt werden sollte damit die Kaufkraft der Rentner. Elegant aussen vor blieb die Frage, wer dies wie zu bezahlen hat.
Die technische Umsetzung der 13. AHV-Rente ist gelöst. Die 13. Rente wird erstmals im Dezember 2026 in Form eines Zwölftels der Jahresrente an alle Personen ausbezahlt, die in diesem Monat eine AHV-Rente beziehen. Die Auszahlung hat zudem keine Auswirkungen auf den Anspruch auf Ergänzungsleistungen. Damit steigen die Kosten der AHV um jährlich rund 4 Milliarden Franken. Dies führt dazu, dass ab der ersten Auszahlung die Umlagekonten der AHV in die roten Zahlen rutschen werden. Dieses Defizit addiert sich zu der seit langem bekannten Unterdeckung aufgrund der demografischen Entwicklung.
Der Bundesrat hat zur Finanzierung der 13. AHV-Rente einen ersten Vorschlag gemacht. Diese sollte ausschliesslich durch eine Erhöhung der Mehrwertsteuer um 0,7 Prozentpunkte finanziert werden. Eine einfache, aber umstrittene Lösung, auch weil sie mit einer Senkung des Bundesbeitrages an die AHV einherginge.
Angesichts der doppelten Herausforderung, die Finanzierung der 13. Rente sicherzustellen und die AHV-Konten zu stabilisieren, wird im Parlament fieberhaft nach einer nachhaltigen Lösung gesucht. Dabei stellen sich grundlegende Fragen: Soll man sich ausschliesslich auf die 13. Rente konzentrieren oder die Finanzierung der 1. Säule insgesamt anpacken? Und was wäre die Lösung, wenn 2026 oder 2027 eine neue Initiative – wie diejenige zur Abschaffung der Rentenplafonierung für Ehepaare- die Finanzierungslücke noch weiter ansteigen liesse?
Es fehlt eine strukturelle Vision
Die Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Ständerats hat den Vorschlag des Bundesrats verworfen. Sie prüft eine Finanzierung, die sich aus verschiedenen Finanzierungs-Komponenten zusammensetzt: eine Erhöhung der Mehrwertsteuer um 0,5 Prozentpunkte zur Finanzierung der 13. Rente, eine zweite Erhöhung um 0,5 Prozentpunkte im Falle einer Zustimmung zur Abschaffung der Rentenplafonierung für Ehepaare sowie eine Erhöhung der Lohnbeiträge um 0,4 Prozentpunkte, was teilweise durch eine Senkung des Beitrags für die Arbeitslosenversicherung um 0,2 Prozentpunkte ausgeglichen werden soll.
Im Mai dieses Jahres har der Bundesrat die Grundzüge des Projektes „AHV30“ vorgestellt, welches mittelfristig die finanziellen Ungleichgewichte beheben soll. Aber auch hier: Es werden einzig Vorschläge unterbreitet für zusätzliche Einnahmequellen in Form einer Erhöhung der Mehrwertsteuer und der Lohnbeiträge. Die grundlegenden Parameter des Systems, die zentrale Frage der Demografie (weniger die einzahlen, mehr die beziehen) werden weder thematisiert, noch finden sich strukturelle Massnahmen zur Bewältigung der Herausforderungen, vor welcher die AHV steht. Einzig Massnahmen zur Erhöhung der bekannten Einnahmen kann man beim besten Willen nicht als Reform bezeichnen.
Diese Entwicklung ist enttäuschend und besorgniserregend. Man will strukturelle Finanzierungslücken des Systems mit linearen Erhöhungen der bestehenden Finanzierungsquellen stopfen, ohne dessen Architektur zu überarbeiten. Es ist zudem erstaunlich, dass die Finanzierung der Abschaffung der Rentenplafonierung für Ehepaare bereits in die Szenarien integriert ist, obwohl die Initiative weder zur Abstimmung vorgelegt noch ein Gegenvorschlag ausgearbeitet wurde.
„Ausschliesslich auf eine Erhöhung bekannter Finanzierungsmittel zu setzen ist etwa so, als würde man ein Haus, dessen Fundamente seit 1948 nicht mehr überprüft wurden, um weitere Stockwerke aufstocken.“
Beitragsdauer wäre ein Schlüssel zu einer gerechteren Reform
Was fehlt und dringend notwendig wäre, ist eine Gesamtsicht und nachhaltige Lösungen für die Finanzierung. Die Alterung der Bevölkerung setzt das System in der Tat unter Druck. Aber auf diese Entwicklung ausschliesslich mit zusätzlichen Finanzmitteln zu reagieren, ist etwa so, als würde man ein Haus, dessen Fundamente seit 1948 nicht mehr überprüft wurden, um weitere Stockwerke aufstocken.
Es gibt einen vielversprechenden Lösungsansatz: die Beitragsdauer. Das von Centre Patronal vorgeschlagene Modell sieht vor, dass der Anspruch auf Rente nicht mehr von einem festen Rücktrittsalter abhängt, sondern von den geleisteten Beitragsjahren. Personen, die bereits in jungen Jahren mit dem Beitragszahlen begonnen haben, könnten somit früher in Rente gehen. Personen, die ein Studium absolviert haben, würden nicht benachteiligt, da die während des Studiums gezahlten Mindestbeiträge ebenfalls berücksichtigt werden. Dieses System führt eine Logik ein, die besser auf die Vielfalt der Lebensentwürfe zugeschnitten und damit der Gesamtsituation gerechter wird.
In Verbindung mit einer moderaten Erhöhung der Mehrwertsteuer und der Lohnbeiträge trägt dieses Modell auch der kontinuierlichen Steigerung der Lebenserwartung Rechnung. Alle zehn Jahre kommt für die 65-Jährigen im Durchschnitt ein weiteres Lebensjahr hinzu. Das ist ein erfreulicher Fortschritt, bedeutet aber auch mehr Jahre im Ruhestand – und damit automatisch Mehrkosten für die AHV.
Durch die ständige Segmentierung der verschiedenen Teilprojekte und das Ausklammern grundlegender Fragen besteht die Gefahr, dass das gesamte Vorsorgesystem geschwächt wird. Es ist an der Zeit, eine echte Strukturreform zu wagen, die den heutigen demografischen und wirtschaftlichen Herausforderungen gerecht wird.