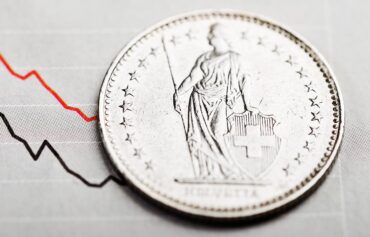- Altersvorsorge, Parlament, Politik, Wirtschaft - Pierre-Gabriel Bieri
AHV 2030: Vorschläge bleiben mutlos

AHV 2030: Vorschläge bleiben mutlos. Der Bundesrat hat die ersten Ziele und Stossrichtungen des Projekts AHV 2030 vorgestellt. Das Parlament hat 2021 hierzu den Auftrag erteilt. Ziel ist, die Finanzierung der ersten Säule bis zum nächsten Jahrzehnt zu stabilisieren. Die vorgeschlagenen Massnahmen beschränken sich jedoch darauf, den immer gleichen Beitragszahlern zusätzliche Kosten aufzubürden, und lassen strukturelle Elemente völlig ausser Acht. Andere Ideen müssen ebenfalls in die Überlegungen einbezogen werden.
Die Quadratur des Kreises
Die erste Säule der Altersvorsorge zu reformieren, stellt eine ständige Herausforderung dar. Die Ausgaben steigen, weil es mehr Rentner gibt und diese im Durchschnitt länger leben. Die Einnahmen, selbst wenn sie steigen, reichen nicht aus, um mit dieser Entwicklung Schritt zu halten – trotz des Wirtschaftswachstums und der zunehmenden Beteiligung von Frauen am Arbeitsmarkt. Um diese Einnahmen weiter zu erhöhen, müsste man entweder die Erwerbstätigen dazu bringen, mehr oder länger zu arbeiten, was nicht den aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen entspricht, oder die Zahl der Erwerbstätigen und damit das Bevölkerungswachstum erhöhen, sei es durch Einwanderung (die stark umstritten ist) oder durch Geburten (wobei Geburtenpolitik selten erfolgreich ist und ihre Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt ohnehin zeitlich verzögert sind).
Angesichts dieser Quadratur des Kreises findet sich die Politik auf etwas feige Weise damit ab, diejenigen, die bereits viel zahlen – Arbeitnehmer, Verbraucher und Steuerzahler – noch stärker zur Kasse zu bitten, obwohl sie weiss, dass dies weder gerecht noch langfristig tragbar ist. Jeder weiss, dass früher oder später eine grundlegende, strukturelle Reform erforderlich ist, aber jeder Versuch scheitert am fehlenden politischen Konsens. Die Reformen STAF (2019) und AHV 21 (2022) waren so konzipiert, dass sie einen Aufschub von etwa zehn Jahren boten – dieser Aufschub wurde jedoch mit der Abstimmung über die 13. AHV-Rente im Jahr 2024 frühzeitig zunichtegemacht.
Niemand möchte das Projekt einer grundlegenden Reform in Angriff nehmen, aber das Thema ist in aller Munde. Im Jahr 2021 nahm das Parlament die Motion an, die den Bundesrat aufforderte, bis zum 31. Dezember 2026 ein Projekt zur Stabilisierung der AHV für den Zeitraum 2030-2040 vorzulegen. Auch wenn sich der Text auf einen Zeithorizont von einem Jahrzehnt bezieht, ist klar, dass sich die Forderung auf eine nachhaltige und substanzielle Reform bezieht. Im Rahmen dieser Strukturreform muss übrigens auch die Frage der Finanzierung der 13. AHV-Rente behandelt werden.
AHV 2030: nur einfache Zusatzfinanzierung
Der Bundesrat ist sich bewusst, dass er auf diese Motion antworten muss, und hat daher kürzlich „die ersten Ziele und Stossrichtungen des Projekts AHV 2030“ bekannt gegeben. In der Medienmitteilung wird auf die Herausforderungen der Zukunft hingewiesen: Die Zahl der Rentner wird von heute 2,5 Millionen in etwa zehn Jahren auf 3 Millionen ansteigen, während das Bevölkerungswachstum – insbesondere das Wachstum der Erwerbsbevölkerung – bescheiden bleiben wird. Welche Lösungen werden also in Betracht gezogen?
Tiefe Enttäuschung herrscht. Trotz so langer Vorbereitungszeit wird eine so dürftige Reform vorgestellt. Der Bundesrat sagt, er wolle „die Einnahmen der AHV über die aktuellen Finanzierungsquellen erhöhen“, d. h. hauptsächlich über Lohnabzüge und Mehrwertsteuer. Es gibt nicht wirklich eine zündende Idee, um den Ausgabenanstieg in den Griff zu bekommen, abgesehen von einigen mässig überzeugenden Massnahmen, um die Attraktivität der Frühverrentung zu verringern und die Erwerbstätigkeit über das Referenzrentenalter hinaus zu fördern. Jede Änderung dieses Referenzalters wird vom Bundesrat ausdrücklich ausgeschlossen.
In ihrer jetzigen Form stellen die genannten Ansätze keine Strukturreform dar. Sie sind lediglich ein zusätzlicher Finanzierungsplan auf Kosten der immer gleichen Beitragszahler. Notwendige Schritte auf der Ausgabenseite werden wieder einmal auf die lange Bank geschoben.
Die genannten Vorschläge stellen keine Strukturreform dar, Bemühungen auf der Ausgabenseite werden erneut aufgeschoben.
Alternative Lösungen sind gefragt
Ein Teil der rechten Parteien beklagt die Weigerung, eine Erhöhung des gesetzlichen Rentenalters in Betracht zu ziehen. Damit würde ermöglicht, auch die Ausgaben zu bremsen. Die Forderung ist verständlich, aber politisch unrealistisch. Die Schweiz ist nicht Dänemark – wo das Rentenalter automatisch an die Lebenserwartung gekoppelt ist. Es muss eine andere Lösung gefunden werden.
Centre Patronal schlägt daher eine andere Lösung vor, ausgehend von der Idee, dass man von Arbeitnehmern, die ihre Berufstätigkeit sehr früh begonnen haben, nicht die gleichen Anstrengungen verlangen kann wie von jenen, die später ins Berufsleben eingetreten sind. In diesem Sinne sollte der Renteneintritt nicht mehr nach einem festen Alter, sondern nach der Anzahl der Beitragsjahre berechnet werden – wobei die Beitragsjahre von Nichterwerbstätigen weiterhin anerkannt würden (z. B. Familienpause oder Studium). Die geleistete Beitragsdauer ist ein gerechteres Kriterium. Ausgearbeitet sollte eine ausgewogene Reform, die sich sowohl auf die Finanzierung, als auch auf die Lebensarbeitszeit in Form von geleisteten Beitragsjahren bezieht.
Dieses Modell wurde Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider vorgestellt, die es auch in einigen Interviews erwähnt hat. Es sollte Teil der Ideen sein, die im Hinblick auf eine Strukturreform in die Vernehmlassung einfliessen.