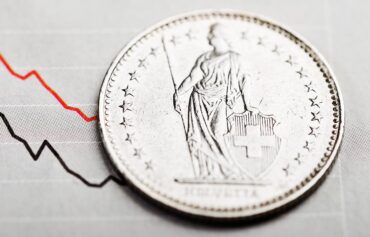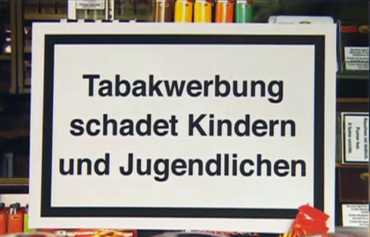- Parlament, Politik, Steuern, Wirtschaft - Pierre-Gabriel Bieri
Bundesausgaben senken: Ziele richtig wählen!

Bundesausgaben senken: Ziele richtig wählen! Die Vernehmlassung zu den vom Bundesrat vorgeschlagenen Sparmassnahmen führt zu einer Vielzahl von Einwänden, auch von Anhängern orthodoxer Haushaltsauffassung. Massnahmen, mit denen finanzielle Lasten auf die Kantone abgewälzt werden, sind inakzeptabel, wie auch solche, die Investitionen in die Infrastruktur gefährden. Weitere Einsparungsmöglichkeiten müssen bei den gebundenen Ausgaben, bei den Subventionen sowie auch in der Funktionsweise der Bundesverwaltung selbst gesucht werden.
59 Massnahmen vorgeschlagen
Die Ausgaben des Bundes steigen immer noch schneller als die Einnahmen – und diese sind noch lange nicht versiegt. Angesichts der drohenden strukturellen Defizite von bis zu 3 Milliarden Franken ab 2027 hat der Bundesrat im Januar dieses Jahres ein Entlastungsprogramm mit 59 Massnahmen vorgestellt, die den Bundeshaushalt bis 2027 um 2,7 Milliarden Franken und bis 2028 um 3,6 Milliarden Franken entlasten sollen. Die vorgeschlagenen Massnahmen stammen hauptsächlich aus dem im September 2024 veröffentlichten Bericht der Expertengruppe unter Führung von Serge Gaillard, einem ehemaligen hohen Beamten und früheren Gewerkschafter.
Die offene Konsultation zu diesem Massnahmenpaket ist gerade erst zu Ende gegangen und eine Reihe von Reaktionen wurde veröffentlicht. Wenig überraschend plädieren die meisten Organisationen in ihren Stellungnahmen für sich selbst und bestreiten erbittert jede Sparmassnahme, die sie selber – und damit notwendigerweise unverzichtbare Aufgaben – betreffen könnte. Die grossen Wirtschaftsverbände, so könnte man meinen, müssten logischerweise alles befürworten, was die öffentlichen Ausgaben senkt… Nun, dem ist nicht ganz so.
Zunächst muss daran erinnert werden, dass das vom Bundesrat vorgelegte Entlastungspaket zwar hauptsächlich Ausgabenkürzungen empfiehlt, aber dennoch eine Massnahme enthält, welche auf eine Steuererhöhung abzielt, indem die Steuer auf Kapitalbezüge aus der zweiten und dritten Säule der Vorsorge erhöht wird. Diese Massnahme, die einen grossen Teil der Bevölkerung träfe, wird einhellig und zu Recht abgelehnt. Eine Bestrafung von Kapitalbezügen würde nämlich das Vertrauen in die berufliche Vorsorge und in das Drei-Säulen-System untergraben. Zudem verstiesse dies gegen den Verfassungsgrundsatz der steuerlichen Gleichbehandlung von Versicherten, die sich für eine Rente entscheiden, und solchen, die es vorziehen, ihr Kapital ganz oder teilweise zu beziehen.
Es ist unerlässlich, weiter über andere Einsparungsmöglichkeiten nachzudenken und dabei auf die zahlreichen gebundenen Ausgaben sowie die vielen gewährten Subventionen abzuzielen.
Keine Abwälzung von Lasten auf die Kantone!
Aber auch die Vorschläge für Ausgabenkürzungen finden bei weitem keine allgemeine Zustimmung, selbst in Kreisen, die eine bessere Kontrolle der öffentlichen Ausgaben befürworten. In seiner Stellungnahme weist Centre Patronal auf mehr als ein Dutzend untaugliche Massnahmen hin. Dabei handelt es sich in erster Linie um Massnahmen, welche langfristig und mehr oder weniger direkt finanzielle Lasten auf die Kantone abwälzen – was sicherlich kein geeigneter Weg ist, um Bundesausgaben zu senken.
Zweitens dürfen keine Kürzungen bei Investitionen vorgenommen werden, die für die Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz, ihren Zusammenhalt und ihre internationale Ausstrahlung sowie für die Modernisierung ihrer Infrastruktur unerlässlich sind. Zu denken ist hier an die Bereiche Berufsbildung, Hochschulen, Strassen- und Schienenverkehr (insbesondere die Speisung der Infrastrukturfonds) oder auch die Unterstützung des internationalen Genfs. Einige der vorgeschlagenen Massnahmen sind aufzugeben, andere könnten in anderer Form überdacht werden.
Notwendige Überlegungen zu weiteren Einsparungsmöglichkeiten
Das Sparpaket des Bundesrates stösst in seiner jetzigen Form auf eine Vielzahl von Einwänden, selbst unter den Verfechtern einer orthodoxen Haushaltsauffassung. Bedeutet dies, dass Karin Keller-Sutter die Hände in den Schoss legen und die Bemühungen um einen ausgeglichenen Bundeshaushalt aufgeben sollte? Ganz bestimmt nicht!
Die Kritik der Wirtschaft bezieht sich nur auf eine Minderheit der vorgeschlagenen Massnahmen, was Spielraum für Fortschritte lässt. Es ist wichtig, die Überlegungen zu weiteren Einsparungsmöglichkeiten fortzusetzen und dabei insbesondere die zahlreichen gebundenen Ausgaben, die in den ursprünglichen Überlegungen der Expertengruppe zu stark vernachlässigt wurden, sowie die zahlreichen Subventionen, die nicht alle für das Funktionieren der Schweizer Gesellschaft unerlässlich sind, in den Fokus zu rücken. Es muss unermüdlich und wiederholt darauf hingewiesen werden, dass die Ausgaben des Bundes in den letzten drei Jahrzehnten explodiert sind, von etwa 30 Milliarden Franken im Jahr 1990 auf heute über 80 Milliarden, was einem Anstieg von 167% entspricht, während im gleichen Zeitraum das BIP nur um 111% und die Bevölkerung um 25% gewachsen ist. Aktuelle Prognosen gehen davon aus, dass die 100 Milliarden-Marke in weniger als zehn Jahren überschritten wird. Man wird uns nicht glauben machen, dass es unmöglich ist, solche Budgets zu kürzen.
Ein weiterer Punkt ist das Lohngefälle zwischen Angestellten der Bundesverwaltung und der Privatwirtschaft: Laut einer Studie der Universität Luzern verdienen Angestellte der Bundesverwaltung im Durchschnitt fast 12% mehr als Angestellte der Privatwirtschaft. Eine Motion von Nationalrat Jürg Grossen (24.3780) fordert, diese Kluft zu verringern. Der Bundesrat, der die Legitimität dieser Forderung anerkannt hat, hat soeben ein Projekt zur „Optimierung des Lohnsystems“ in der Bundesverwaltung veröffentlicht, allerdings mit bescheidenen Ambitionen, da er festhält, dass das neue System „mittel- bis langfristig die Lohnkosten leicht verringern sollte“.
Einsparungsmöglichkeiten müssen auch in der Funktionsweise der Bundesverwaltung selbst gesucht werden.
Stellungnahme Centre Patronal
Weiterführende Informationen:
Eidgenössische Finanzverwaltung EFV: Ausgaben nach Aufgabengebieten 2024
Studie von Martin Mosler, Christoph A. Schaltegger und Simon Schmitter: Klarheit schaffen: Der IWP-Subventionsreport 2024